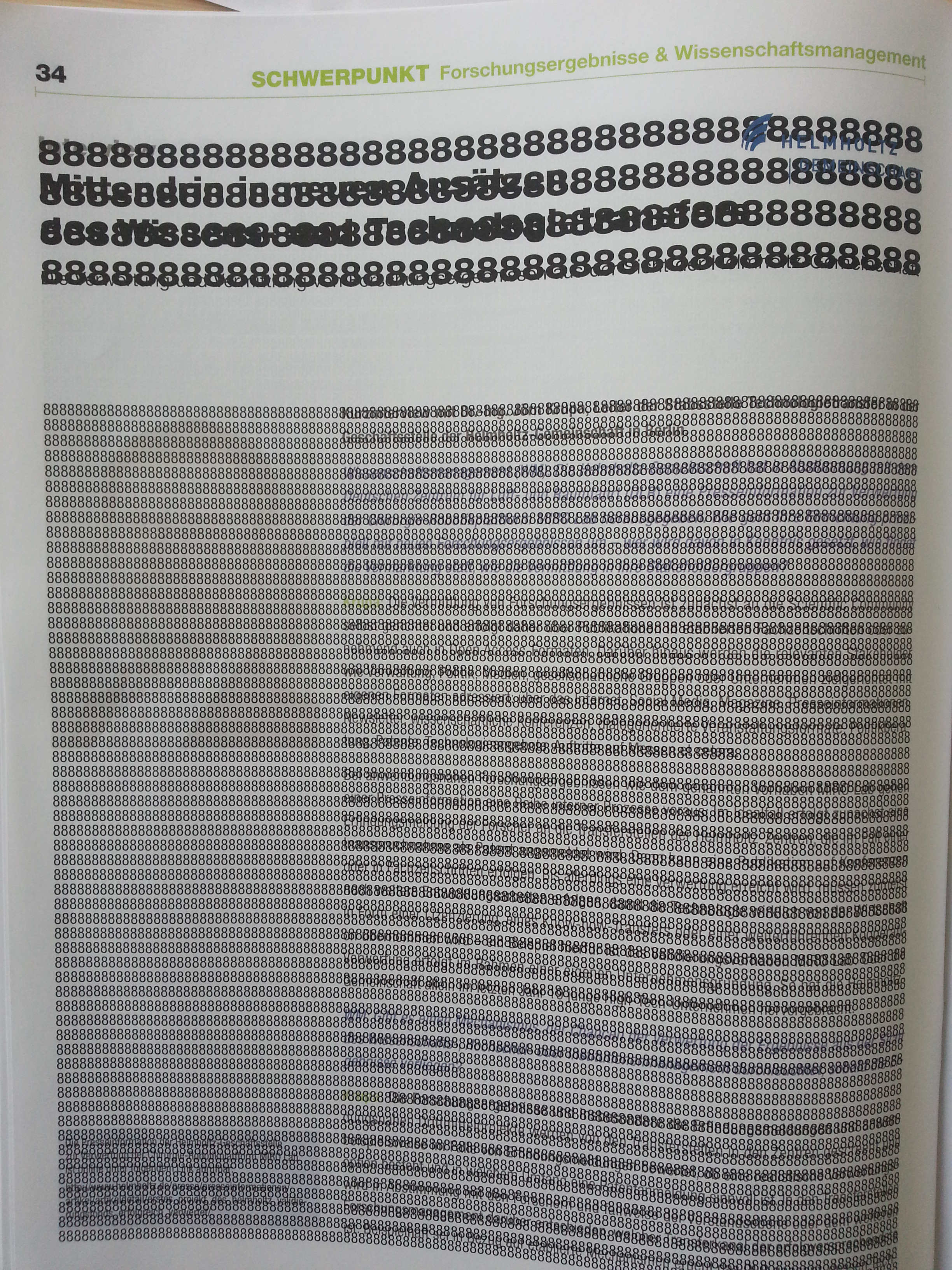Der March for Science am 22. April 2017 hat der Wissenschaft in Deutschland viel positive Aufmerksamkeit beschert. Gleichzeitig wächst der Druck: Die Kommunikation nach außen und die Haltung nach innen erscheint Kritikern reformbedürftiger denn je. Andererseits erscheint das Wissenschaftssystem dieses Mal auch bereit dazu. Das verdient breite Unterstützung. Und eine Tagung am 25. und 26. Oktober 2017 von VolkswagenStiftung, ZEIT, Leopoldina und Robert Bosch Stiftung

Ich glaube, so viele wohlmeinende Schlagzeilen hat die deutsche Wissenschafts-Community seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt wie am 22. April 2017 – dem Tag des „March for Science“. An gut zwei Dutzend Standorten sollen 37.000 Menschen auf den Beinen gewesen sein. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist das wenig. Doch angesichts bürgerlicher Behäbigkeit, die sich ohnehin kaum für oder gegen irgendetwas mobilisieren lässt, war das ganz beachtlich.
Gut vier Monate danach sei nun aber die Frage erlaubt: Was hat der March for Science gebracht?
Guckt man auf die Habenseite, dann kann man wohl konstatieren: Das Personal an Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, zumal in leitenden Funktionen, hat verstanden, dass ein neuer Umgang mit gesellschaftlichen Kräften nun wohl doch unvermeidlich geworden ist, wenn man nicht noch weiter aus der Mitte der Gesellschaft driften will. Dass „die“ Gesellschaft „die“ Wissenschaft in der Herausforderung sieht, ihre Relevanz überzeugend deutlich zu machen und Verantwortung bei der Lösung von Zukunftsfragen zu übernehmen.
Schlagworte wie „Transparenz“ und „Partizipation“, mit denen man sich in Wissenschaftskreisen bislang wenig euphorisch auseinandergesetzt hat (es gibt natürlich auch rühmliche Ausnahmen in der Professorenschaft!), bekommen plötzlich neues Gewicht. Das Volk, aber auch Politiker und Interessenverbände, klopfen zunehmend lauter an das Tor im Elfenbeinturm. Und drinnen fragt man sich: Was tun? „Wir haben ein dramatisches Vermittlungsproblem“, konstatierte Peter Strohschneider, der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft – und zwar bereits vor dem March for Science, aber bereits unter dem Eindruck weltweiter Wissenschafts- und Experten-Skepsis sowie Fake News.
Was hat der „March for Science“ noch gebracht – außer Selbstzweifeln in der Scientific Community?
Mir scheint, der „March for Science“ hat einen Geist freigesetzt, der sich nicht mehr in die Flasche zurückdrängen lässt. Es scheint, als formierte sich im Innern des Wissenschaftssystems Widerstand gegen die „So-war-es-schon-immer-bei-uns-und-so-bleibt-das-auch“-Mentalität. Deutlich wurde das bei den Kundgebungen am 22. April, wo insbesondere aus dem wissenschaftlichen Mittelbau kecke Töne zu hören waren, die sich mutig gegen die Beharrungskräfte im Apparat aussprachen. Für mich, als Teilnehmer in Berlin, klang das schon richtig politisch.
Weitere Indizien für latente Opposition lieferte mir neulich eine Diskussion, die Manuel Hartung, Ressortleiter Chancen bei der ZEIT, und ich mit 80 Nachwuchswissenschaftler/innen aus der Förderung der VolkswagenStiftung hatten. Unser Thema „Die Krise der Klugen“. So hatte Hartung im Frühjahr 2017 einen ZEIT-Artikel überschrieben, in dem er die Frage formulierte: „Wo bleibt eigentlich der Aufschrei der Wissenschaft“, angesichts verdrehter wissenschaftlicher Tatsachen (Trump), unverhohlener Wissenschaftsfeindlichkeit (Erdogan, Orban) und grassierender Wissenschaftsskepsis (weltweit)? Hartungs Eindruck: „Die deutschen Professoren fühlen sich von der rasenden Wirklichkeit um sie herum vor allem in ihrer Arbeit gestört.“
Wachsendes Unbehagen vor allem bei Nachwuchswissenschaftlern
Wer nun annimmt, dass der ZEIT-Redakteur wegen seiner Kritik von den anwesenden Wissenschaftler/innen niedergebuht wurde, sah sich widerlegt. Im Gegenteil: Das Gros stellte seine Polemik überhaupt nicht in Frage, sondern brachte eigenes persönliches Unbehagen zum Ausdruck, dass man im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Erwartung einerseits und dem modernisierungsresistenten Wissenschaftsbetrieb andererseits verspüre.
So scheint sich das Wissenschaftssystem ganz, ganz langsam in zwei Lager aufzuspalten die Wandlungswilligen und die Status Quo-Verteidiger. Es gärt. Und ich glaube, dieses Verdienst darf man dem „March for Science“ getrost anrechnen.
Und nun? Mit Blick auf die Kommunikation mit einem breiten Publikum erschallt vielerorts der reflexhafte Ruf nach „neuen Kommunikationskonzepten“. Das klingt dynamisch, verpflichtet zu nichts und vertagt konkrete Schritte auf eine nicht näher befristete Zukunft. Dabei haben die Kommunikationsprofis in den Universitäten, Hochschulen und Forschungsbereichen über die Jahre ein ständig modernisiertes und diversifiziertes Instrumentarium an Kommunikationsmitteln geschaffen, inklusive Leitlinien für die bestmögliche Handhabung – auch und gerade mit Blick auf ein differenziertes Laien-Publikum.
Verantwortung für Wissenschaftsvermittlung lässt sich nicht immer delegieren
Wäre es nicht ein guter erster Schritt, wenn sich die Entscheider im Wissenschaftsbetrieb, die jetzt „neue Konzepte“ fordern, erstmal die bereits bewährten von ihren PR- und Kommunikationsabteilungen erklären ließen? Denn ich unterstelle, dass das Wissen um die Wirkungsweisen von Kommunikationsmitteln im wissenschaftlichen Personal nach wie vor nicht sehr verbreitet ist. Dabei sollte auch das eine Erkenntnis nach dem „March for Science“ sein: Dass man Wissenschaftsvermittlung nicht immer nur an Kommunikationsabteilungen wegdelegieren kann, sofern man als Wissenschaftler bei einem breiten Publikum glaubwürdig erscheinen will. Das eben setzt den vielbeschworenen Dialog auf Augenhöhe voraus.
Verstärktes Engagement bei der Wissenschaftsvermittlung zieht natürlich die altbekannten Einwände der Wissenschaftler nach sich: Was bringt mir das für meine Karriere? Soll ich neben meiner Lehr-Labor-Arbeit auch noch Volkshochschule machen? Wofür haben wir Kommunikationsfachleute, wenn ich alles selbst machen muss usw.?
Eine allzu vertraute Litanei. Und doch: Seit dem „March for Science“ klingt sie anders. Nicht mehr nach einem kategorischen „Nein“, sondern immer öfter nach einem vorsichtig tastenden „Wenn…dann…“
Aufbruchsstimmung? Ja, ich glaube, seit dem PUSH-Memorandum 1999 war die Bereitschaft in Wissenschaftskreisen niemals größer, tradierte Standpunkte kritisch zu reflektieren und offen zu sein für neue Impulse. Der Dialog auf Augenhöhe, der zwischen Wissenschaft und breiter Öffentlichkeit immer eher verdruckst und mit viel Anschieben funktioniert hat, könnte langfristig selbstverständlicher werden.
Wie die Öffnung der Wissenschaft besser gelingt und ihr Nutzen für die Lösung gesellschaftlicher Zukunftsfragen sichtbarer werden könnte – dafür gibt es nicht die eine Lösung. Und es sollte auch nicht allein in der Verantwortung der Wissenschaft bleiben, Lösungen zu finden. Politik, Journalismus, gesellschaftliche Interessengruppen – sie alle sind aufgerufen, am Gelingen dieses Projektes mitzuwirken.
Vielleicht braucht es dafür gar nicht viele neue Konzepte, sondern vor allem mehr Schulterschluss?
Einen Anstoß dazu will eine Tagung bieten, die die VolkswagenStiftung in Kooperation mit der Leopoldina, der ZEIT und der Robert Bosch Stiftung am 25. und 26. Okt. 2017 in Hannover anbietet: „Wissenschaft braucht Gesellschaft – Wie geht es weiter nach dem March for Science?“.
Welche Erwartungen die Organisatoren, zu denen ich selbst zähle, mit dieser Veranstaltung verbinden, will ich in den nächsten Wochen hin und wieder an dieser Stelle berichten. Und eure Meinung und Wünsche dazu kennenlernen. Schreibt sie in die Kommentarspalte. Ich freue mich darauf, sie zu lesen und in meinen Beiträgen darauf einzugehen.
Hier geht es zum Programm und zur kostenlosen Anmeldung: www.volkswagenstiftung.de/wowk17
Weiterer Veranstaltungshinweis:
„Speak up for Science – eine offene Konferenz für kommunizierende Wissenschaftler“ veranstaltet Wissenschaft im Dialog am 15. und 16. Sept. 2017 in Berlin. Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich.
Blogbeiträge zum „March for Science“:
Im Blog „Wissenschaft kommuniziert“ findet sich eine Fülle von Artikeln und Statements über verschiedene Aspekte des „March for Science“