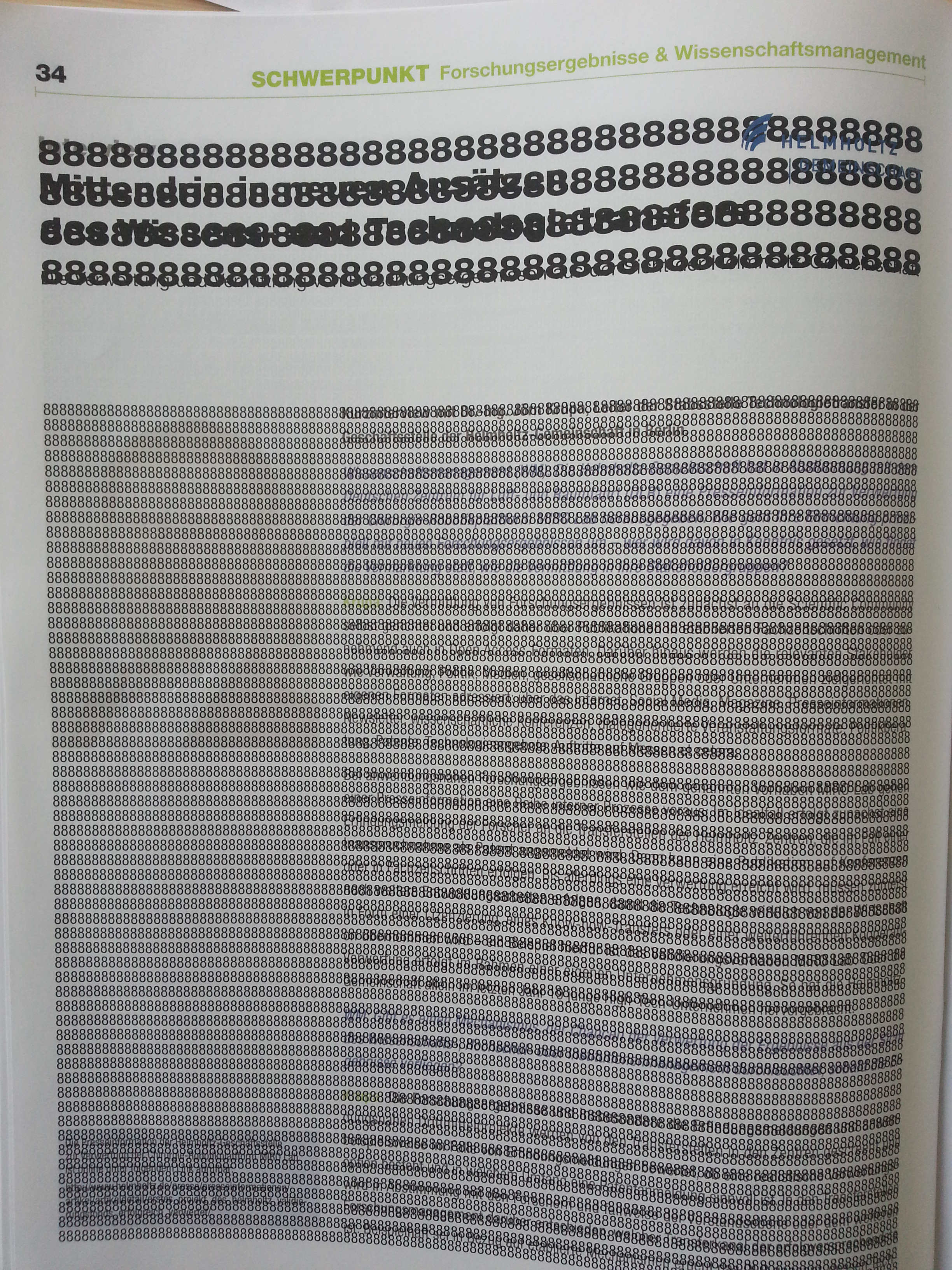John Oliver hat es in seiner jüngsten Show „Last Week Tonight“ auf HBO getan und Sabine Rückert von der ZEIT in der aktuellen Ausgabe (S.2-3): Beide fordern ihre Zuschauer und Leser auf, Zeitungen zu kaufen und so die Demokratie zu stärken. Andernfalls, so heißt es beim Satiriker, werden korrupte Politiker eine fabelhafte Zukunft haben, weil es demnächst keine investigativen Journalisten mehr gibt. Und beim Wochenblatt sind es zehn Gebote unter der Überschrift „Was ich tun kann, um die Demokratie zu stärken, in der ich lebe“ (S.2-3); dort heißt es unter Ziffer 4: „Ich informiere mich. Ich höre, lese oder sehe Nachrichten, kaufe gute Zeitungen (zahle für sie auch im Internet), damit erhalte ich die selbstbewusste und kritische Presse, die unsere Demokratie vor autoritären Einflüssen schützt (…)“.
#Brüssel: Warum mir dieser Journalismus Angst macht
Das Mantra des etablierten Journalismus lautet: „recherchieren, analysieren, einordnen“. Mit solchem Ethos, mit fachlicher Expertise und fundierten Einschätzungen, will sich der sogenannte Qualitätsjournalismus absetzen vom oftmals oberflächlichen Gesummse in den sozialen Netzwerken. Doch was hat dieser postulierte Anspruch mit der Wirklichkeit zu tun? Wenig. Die mediale Begleitung der heutigen Terroranschläge in Brüssel liefert dafür erschütternde Beispiele. Wieder einmal.
Wissenschaftsjournalismus: Die Nische als Daseinsform?
Im Sommer 2015 protestierten freie Wissenschaftsjournalisten aus Rundfunk und Fernsehen gegen Streichungspläne des WDR. Doch anders als bei früheren Anlässen wurden die Delinquenten dieses Mal von einer spontanen Solidarisierungswelle begleitet. Dem Intendanten Tom Buhrow, der die Wissenschaftsberichterstattung zuvor als „Nische“ im Ökosystem seines Hauses geringschätzt hatte, setzte die Wissenschafts-Pressekonferenz WPK eine eilig erstellte Website „keine-nische.de“ entgegen, auf der Repräsentantinnen und Repräsentanten bunter Provenienz preisgaben, warum sie Wissenschaftsjournalismus für unverzichtbar halten.
Verstaatlicht den Journalismus! Sofort!
Wenn Kunden nicht jene Dinge konsumieren, die ihnen die Industrie anbietet, ist es hierzulande gute Sitte, dass die Wirtschaft nach staatlicher Hilfe ruft. In deren Genuss kamen so z.B. die Solar- und Autoindustrie („Abwrackprämie“). Fette Subventionen für die Verbraucher ließen die Nachfrage explodieren und die Konzernkassen ohrenbetäubend klingeln. Am Ende waren alle zufrieden. Weiterlesen
„Guten Journalismus gibt es nicht zum Nulltarif!“
Chefredaktion und Geschäftsführung von Correctiv haben mich kürzlich gebeten, über die Rolle von Stiftungen in der Journalismusförderung zu sprechen. Dies ist mein gekürzter und überarbeiteter Vortrag.
„Demokratie funktioniert nicht ohne informierte Öffentlichkeit“, heißt es in einer Erklärung, in der deutsche Stiftungen kürzlich ihre Sorge über die Erosion im unabhängigen und kritischen Journalismus zum Ausdruck gebracht haben.
Die Erklärung wurde naturgemäß besonders von der Medienbranche aufgegriffen und von den journalistischen Lobbyverbänden begrüßt. Dass Stiftungen sich als Förderer journalistischer Projekte mehr engagieren sollten, wird in letzter Zeit immer öfter gefordert: von Kommunikations- und Medienwissenschaftlern, von den Branchenverbänden und teilweise auch von Politikern.
Als Vertreter der VolkswagenStiftung habe ich an der Erklärung mitgearbeitet und als Mitinitiator des Expertenkreises Stiftungen und Qualitätsjournalismus führe ich viele Gespräche mit Leuten, die sich von einer konzertierten Aktion der Stiftungen offenbar einen Geldregen für journalistische Startups erhoffen. Denen muss ich sagen: Selbst bei einem denkbar großzügigen Einsatz von Stiftungen darf man sich die Rettung des Journalismus von ihnen nicht erwarten. Das, was den Stiftungen die Journalismusförderung bislang wert war, ist finanziell sehr, sehr wenig – gemessen am Umsatz im deutschen Medienmarkt.
Stiftungen wollen auch gar nicht den Journalismus retten. Sie können – und das entspricht auch ihrem Selbstverständnis – Experimentelles ermutigen, Leuchttürme finanzieren und Akteure miteinander vernetzen, die sonst vielleicht nicht miteinander reden würden.
Wichtiger als Budgetspekulationen ist mir persönlich aber die Frage: Wollen die Stiftungen dem Journalismus in Deutschland überhaupt unter die Arme greifen? – Da lohnt ein Blick auf die Arbeit des Expertenkreises Stiftungen und Qualitätsjournalismus.
Dessen Gründung ging meine Anfrage an den Bundesverband Deutscher Stiftungen voraus, wie sich Stiftungen in der Frage der Sicherung des unabhängigen und kritischen Journalismus in Deutschland positionieren wollten? Letztlich verstehen sie sich ja als Vertreterinnen zivilgesellschaftlicher Interessen. Und wenn sich die Zeichen mehren, dass der Journalismus seine ihm zugeschriebene Rolle als vierte Gewalt, als Kontrollinstanz im demokratisch verfassten Gemeinwesen perspektivisch nur noch unzureichend wahrnehmen kann, ist es dann nicht Aufgabe von Stiftungen, sich in diesen Prozess, verharmlosend auch Medienwandel genannt, einzubringen?
So kam es zu bislang drei Treffen mit jeweils etwa 20 Stiftungen. Das erste greifbare und aus meiner Sicht ermutigende Ergebnis: Obwohl der Kreis extrem heterogen zusammengesetzt ist, aus einigen großen und überwiegend kleinen Stiftungen, die obendrein alle verschiedene Stiftungsstrategien verfolgen und eigenen Satzungsgeboten unterliegen, teils schon Journalismusförderung betreiben, teils noch gar nicht, haben wir es geschafft, eine gemeinsame Erklärung zu verabschieden, mit der sich der Kreis am 22. September 2015 erstmals bemerkbar gemacht hat.
Mehr noch: 26 Vorstände und Geschäftsführungen von Stiftungen haben diese Erklärung unterzeichnet. Es ist also gelungen, die Problematik, die bis dahin nur auf der Arbeitsebene der PR-Verantwortlichen aus den verschiedenen Häusern diskutiert wurde, auf die Leitungsebene zu heben und die Entscheider zu zwingen, sich über die Erklärung mit dem Phänomen zu beschäftigen.
Denn das hatte sich schnell herausgestellt: Was in puncto Sicherung des sogenannten Qualitätsjournalismus auf dem Spiel steht, wie weit die Erosion im privatwirtschaftlichen Printbereich – und hier insbesondere bei den Regionalzeitungen – bereits fortgeschritten ist, dass die Informationsvielfalt akut gefährdet ist – all das ist den meisten Stiftungsleitungen genauso wenig oder genauso gut bekannt wie der sogenannten breiten Öffentlichkeit.
Aus dieser pessimistischen Behauptung, die ich hier frech aufstelle, leitet sich eine optimistische These ab: Schätzungsweise 120 Stiftungen sind in der Journalismusförderung tätig oder wollen sich, vom Stiftungskreis inspiriert, künftig in der Journalismusförderung engagieren. Bezogen auf die Gesamtzahl von 21 000 Stiftungen in Deutschland dürfte es aber viele Akteure geben, die noch gar nicht wahrgenommen haben, was für die informierte Zivilgesellschaft auf dem Spiel steht und dass sich da ein Handlungsbedarf abzeichnet, den sie noch gar nicht als solchen erkannt oder anerkannt haben. Und wo sie sich in Zukunft aber fördernd einbringen könnten.
Auch sie will der Stiftungskreis erreichen, er will – und muss – seine Basis verbreitern, um wirkungsmächtig zu werden. (Deshalb wird sich der Expertenkreis beim Deutschen Stiftungstag in Leipzig Anfang Mai 2016 in einer eigenen Veranstaltung präsentieren.) Und es darf m.E. bei der Verabschiedung einer wohlfeilen Erklärung nicht bleiben. Da wird mehr von uns erwartet.
Ungeachtet all dessen, was aus diesem Kreis vielleicht noch kommen mag: Schon jetzt tun Stiftungen was für die Journalismusförderung. Ich verweise auf die zugegebenermaßen noch lückenhafte Übersicht auf der Homepage des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, wo auf Initiative des Expertenkreises zum ersten Mal gebündelt erscheint, als Service für Journalisten, was Stiftungen an Förderung anbieten, und zwar nach folgenden Themenclustern sortiert: Recherche, Bildung, Medienkompetenz, Forschung Preise, Vernetzung.
Trotzdem nochmal die Frage: Hat dieses Angebot dazu beigetragen, den Journalismus in Deutschland besser zu machen? Bei strukturellen Ansätzen, z.B. der Aus- und Fortbildung gewiss. Bei der inflationären Stiftung von Journalistenpreisen dürfte der Effekt, abgesehen von der finanziellen Wohlfahrt der einzelnen Preisträger, gering sein. Aber ich glaube, die Frage muss auch anders gestellt werden, nämlich so:
Spiegeln die aktuellen Förderprogramme der Stiftungen den relevanten Bedarf wider? Gelingt es ihnen, mit ihren Ausschreibungen und Maßnahmen Schritt zu halten mit dem rasanten Medienwandel und -verfall, insbesondere auf der regionalen Ebene? Oder arbeiten sie sich an längst überholten Fragen ab und werden deshalb im Kontext der Diskussion des Medienwandels von den übrigen Akteuren gar nicht als relevante Impulsgeber wahrgenommen? Man diskutiert dann den Medienwandel – aber ohne die Stiftungen.
Auch bei der VolkswagenStiftung, deren Kommunikation ich leite, wurde ein gewisse Diskrepanz deutlich zwischen ihrem erstklassigen internationalen Renommee als private Wissenschaftsförderin – und einer sehr schmal dosierten Förderung im Bereich Wissenschaftsvermittlung und –kommunikation.
Machtvoll zurückgemeldet hat sich die Stiftung in diesem Jahr mit der Ausschreibung „Wissenschaft und Datenjournalismus“. Darin fördert sie acht Projekte – ausgewählt aus mehr als 80 Einsendungen – mit insgesamt 750 000 Euro. Das ist für die Branche viel Fördergeld. Aber es ist auch eine Botschaft seitens der Stiftung damit verbunden: nämlich deutlich zu machen, dass es guten Journalismus nicht zum Nulltarif gibt. Dass wir den kritischen, womöglich investigativen Journalismus brauchen, auch in der Wissenschaft. Aber gerade in den Wissenschaftsressorts wird Kahlschlag betrieben. Wie grotesk: Einerseits sind sich alle einig, dass die Wissenschaft immer wichtiger wird für die Gesellschaft, andererseits wird der Vermittlung von Wissenschaft durch professionelle, unabhängige und kritische Journalisten der Boden entzogen.
Um dem Datenjournalismus aber strukturell und dauerhaft zu mehr Relevanz zu verhelfen, reichen acht Förderprojekte nicht aus. Wir werden den Aktionsradius erweitern müssen und auch Aspekten der Datenkontrolle ein Forum bieten müssen, der Informationspflicht von Behörden, der Qualitätssicherung in der Generierung und Verarbeitung von Daten etc. pp.. Sonst bliebe die Ausschreibung womöglich ohne strukturellen und nachhaltigen Impuls.
Ich glaube, der Expertenkreis Stiftungen und Qualitätsjournalismus hat das Potenzial, sich als einflussreiches Gewicht zu profilieren und als Stimme der Stiftungen von Seiten der Politik, der Medienproduzenten und -wissenschaftler, der Startups und Innovationstreiber wahrgenommen zu werden. Um dem Kreis aber Relevanz zu verleihen, sollte die Journalismusförderung aus meiner Sicht in der Stiftungswelt eine ganz neue Bewertung, Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit erfahren.
Das bedeutet nicht, dass es eine Kollektivverantwortung der Stiftungen für den Journalismus gibt. Auch andere Institutionen, die bislang noch am Spielfeldrand stehen, die Politik bspw., sehe ich hier in der Pflicht.
Ich sagte es eingangs: Stiftungen werden den Journalismus nicht retten. Aber sie könnten sich viel, viel mehr in die Begleitung der aktuellen Debatte einbringen, in der sie m.E. bislang keine Rolle spielen.
Wie man das dann in Einklang mit dem eigenen Stiftungszweck bringt, muss jedes Haus für sich lösen. Es gibt, wie gesagt, keine Kollektivverantwortung der Stiftungen für den Qualitätsjournalismus. Aber es gibt eine Verantwortung gegenüber der Zivilgesellschaft, der Stiftungen nicht gerecht werden, wenn sie beispielsweise dem Verschwinden des Wissenschaftsjournalismus als einem Genre tatenlos zusehen. Und bei ihren Förderungen eben nicht unterscheiden zwischen kurzfristiger Projektförderung und nachhaltiger Strukturentwicklung.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
SPIEGEL blamiert sich mit Social Media-Schelte für @RegSprecher
Im Zuge der Deinstallation des Chefredakteurs Wolfgang Büchner im vergangenen Jahr wurde mir als externem Beobachter nochmal deutlich, dass sich das SPIEGEL-Universum in zwei Sphären teilt, die augenscheinlich wenig Berührungspunkte haben und ganz gewiss keinen Transfer an Know-how: Oben ist Print, unten ist Online. An dieser Hierarchie haben 15 Jahre Medienkonvergenz nichts geändert, zumindest nicht beim SPIEGEL.
Und auch nur vor dem Hintergrund dieses unbeirrbaren gegenseitigen Ignorierens lässt sich meines Erachtens erklären, wie es der Artikel ins Heft geschafft hat (Nr.47 vom 13.11.2015), um den es hier geht: „Revolutionäre Grüße ;-)“ (Seite 42).
Im Vorspann heißt es: „Regierungssprecher Seibert baut die Facebook-Seite des Presseamts zu einer Art Staatsfernsehen aus. Die Opposition zweifelt, ob das erlaubt ist.“
Um eine Pointe gleich vorwegzunehmen: Die Zweifel der Opposition sind natürlich nur vorgeschoben (was soll eine Opposition denn anderes tun, als an der Regierung zu zweifeln?). In Wahrheit ist es der SPIEGEL, der es blöd findet, dass die Journalisten ihr Exklusivrecht auf Informationen verloren haben und auch die Leser sich die Welt nicht mehr nur von SPIEGEL-Leuten erklären lassen wollen.
Zum Kristallisationspunkt dieser ganzen – aus SPIEGEL-Sicht – verhängnisvollen Entwicklung haben sich die Autoren also Steffen Seibert ausgeguckt – den ersten Sprecher einer Bundesregierung, der die Chancen von Social Media begriffen hat und für das einsetzt, wofür er bezahlt wird: Ruhm und Ansehen der Kanzlerin zu mehren.
Offenbar haben aber die SPIEGEL-Autoren ein anderes Bild vom Beruf eines Regierungssprechers. Sie konstatieren „ein ernstes Problem“, nämlich eine Vermengung von „zulässiger Pressearbeit und parteiischer Werbung“. Und verweisen zur Unterfütterung ihrer These auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts – aus dem Jahr 1977 (!), also von vor fast vierzig Jahren, als vermutlich nicht mal SPIEGEL-Redakteure sich ein Internet vorzustellen vermochten, geschweige denn den globalen Siegeszug der sozialen Netzwerke.
Deren Funktionsweise haben sie allerdings bis auf den heutigen Tag nicht begriffen, zumindest nicht die Artikelautoren. Als wäre es ein Sündenregister, listen sie auf, wie Seibert und seine Leute bei Facebook und Twitter unterwegs sind. „Statt nüchtern mitzuteilen, dass die Kanzlerin Staatsgäste getroffen hat“, würde Seibert schrägerweise die Begrüßungskapelle filmen oder die Geschichte „eines schwarz-rot-goldenen Staubwedels“ erzählen.
Seibert poste von Rollbahnen und aus Hotelzimmern, filme den Landeanflug auf Rom und den US-Präsidenten Barack Obama, wie der gerade mit einem Kaffeebecher lässig durch die Hotellobby schlurft und im Vorbeigehen „Good Morning“ in Seiberts Handykamera sagt. „Das Video sahen gut 50 000 Nutzer“, heißt es im Artikel. Und ist, wie alles andere davor auch, offenbar als Schelte gemeint.
Liebe SPIEGEL-Autoren, ich bin kein Mitglied der Regierungsparteien. Trotzdem wünschte ich mir sehr viel mehr Kommunikationskönner vom Format eines Steffen Seibert – gerade im Journalismus! Wer im sozialen Netzwerk auffallen möchte, sollte originell sein, überraschend, authentisch. Natürlich ist Angela Merkel keine Kanzlerin zum Anfassen. Aber dieses Bild muss Seibert der Bevölkerung vermitteln. Videoschnipsel „aus den Hinterzimmern der Macht“ (SPIEGEL) vermitteln den Betrachtern einen Blick hinter die Kulissen und die Illusion, der Kanzlerin nahe zu sein.
Aber davon haben die Autoren keine Ahnung und murren lieber an einer weiteren Schlüsselqualifikation für Social-Media-Könner: der Interaktion über Kommentare. Wie man angesichts von täglich 2500 Kommentaren „mit Störenfrieden“ umgehe, wollen die Autoren von Seibert wissen. Die Nutzer sollten sie „einfach ignorieren“, empfiehlt der, „und räumt damit ein, keine klare Linie im Umgang mit Facebook-Trollen zu haben“ (SPIEGEL).
In Wahrheit folgt Seibert den Gepflogenheiten der meisten Social Media-Moderationen, wo man gewöhnlich auf die Selbstreinigungskräfte innerhalb der Community setzt: „Trolle“ werden von den übrigen Forenbesuchern ignoriert und verlieren rasch die Lust. Löschungen dagegen, wie sie offenbar die SPIEGEL-Autoren von Seiberts Team erwarten, würden Trolle nur als Anstachelung verstehen.
So läuft dieser ganze beklagenswerte Artikel inhaltlich völlig ins Leere und endet als Blamage für das Autoren-Duo – und die SPIEGEL-Redaktion. Ein erschütterndes Zeugnis dafür, wie weit Teile der SPIEGEL-Redaktion noch entfernt sind vom „Neuland“ Internet.
Aber, liebe SPIEGEL-Leute, ich fürchte, Social Media wird bleiben. Deshalb werdet ihr euch an solche Kränkungen gewöhnen müssen, wie ihr sie beispielhaft im Text beschreibt und worin eure ganze Empörung über die Demokratisierung der Meinungsbildung deutlich wird:
„Nach dem G 7-Gipfel sprach Merkel mit dem Facebook-Team, nicht mit einem Sender.“ Und offenbar auch nicht mit dem SPIEGEL.
Wo bleibt der Aufruhr der Wissenschaftsjournalisten? #ww15
Auf der jüngsten WissensWerte (#ww15) in Bremen wurde mir deutlich: Der Wissenschafts-PR steht ihre große Blüte erst noch bevor. Denn wo sonst, angesichts der immer schmaler werdenden „Nische“ für den Wissenschaftsjournalismus, wird die Wissenschaft in all ihrer Komplexität und Vielfalt künftig noch fundierte Würdigung erfahren – wenn nicht in den PR-Broschüren der großen Forschungsinstitutionen und -förderer?
Zugegeben, die Wissenschaftsjournalisten, die in der PR naturgemäß eine Konkurrenz im Ringen um die Aufmerksamkeit des Publikums sehen, können nach wie vor mit Wettbewerbsvorteilen punkten: Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit, Reichweite. Aber was sind diese Tugenden auf dem heutigen Markt noch wert? Wo nicht nur PR-Strategen mit Journalismus imitierenden Hochglanzmagazinen bei Laien (und Politikern und Drittmittelgebern und, und, und) Eindruck schinden, sondern auch das Internet Interessen in allen vorstellbaren Abstufungen in puncto Informationstiefe bedient? Und zwar kostenlos.
Und als wäre diese Realität nicht furchteinflößend genug, fallen den Wissenschaftsjournalisten die eigenen Chefredakteure und Intendanten verstärkt in den Rücken und kürzen und streichen, was schon zuvor stets auf Kante genäht war: recherche-intensive Wissenschaftsberichte. Zusammen mit dem Sachverstand der ausgegliederten Wissenschaftsjournalisten verlieren die Medien auf diese Weise schleichend ihre Wettbewerbsvorteile gegenüber PR und Blogosphäre: erst die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit, danach die Reichweite.
All dies trifft mit der beschriebenen Wucht gewiss (noch) nicht auf die bundesweiten Leitmedien zu, also ZEIT, FAZ, Süddeutsche Zeitung und stern. In der Provinz aber, bei den vielen, vielen Regionalmedien, kommt Wissenschaftsjournalismus längst kaum mehr vor.
Das ist das Konfliktfeld, von berufeneren Expertinnen und Experten als mir sattsam erforscht und unermüdlich beschrieben. Ein bedrohtes Biotop, in dem Wissenschaftsjournalisten um ihre Daseinsberechtigung kämpfen müssen. Die Frage ist nur: Wie lange werden sie noch durchhalten?
Auf der WissensWerte stellte sich mir die Frage anders: Was muss noch passieren, damit die Wissenschaftsjournalisten auf die Barrikaden gehen? Statt Aufrufe zu solidarischen Protesten gab es in den Pausen, wie immer, gedämpften Smalltalk. Bei der Eröffnung der WissensWerte wurde nur mit einem Halbsatz auf die WPK-Aktion „Keine Nische!“ verwiesen, eine virtuelle Protestnote gegen Programmstreichungen im Wissenschaftsbereich des WDR. So beiläufig der Hinweis, so niedrig der Erregungsgrad im Publikum: Null.
Ein anderes Beispiel: In einer Session, die wohl als exemplarischer Schlagabtausch gedacht war, und in der festangestellte WDR-Redakteure gegen freie WDR-Mitarbeiter antraten, verlor sich der Konflikt um Programmstreichung und miese Bezahlung in argumentativen Irrfahrten durch das kafkaeske Rundfunkgebilde. Das Publikum verfolgte weitgehend emotionslos ein zielloses, im Ton stets artiges Gespräch, bei dem weder Freie noch Feste sich emotional engagiert zeigten oder mit Haltung überzeugen konnten. Atmosphärisch wirkte es auf mich genauso wie ich in diesem Jahr die Stimmung unter den versammelten Wissenschaftsjournalisten wahrgenommen habe: müde, kraftlos, ratlos. Gewiss auch desillusioniert.
Verdeckt dieses unterstellte Phlegma den Blick auf die Zukunftschancen des Wissenschaftsjournalismus? Stehen sich die Gebeutelten selbst im Weg? Während in anderen journalistischen Bereichen gegenwärtig ein Startup nach dem anderen von der Rampe geht, bleiben die Wissenschaftsjournalisten handzahm und risikoscheu.
Nur zwei Gründungsteams, die sich auch auf der WissensWerte präsentierten, haben meines Wissens bislang den Sprung ins Unternehmertum gewagt: Das Science Media Center ist über eine Anschubfinanzierung der Klaus Tschira Stiftung zumindest für drei Jahre finanziell abgesichert. Die Macher von „Substanz“ dagegen, die mit großer Aufmerksamkeit seitens der Branche im Sommer 2014 gestartet und im Herbst 2015 in ein Moratorium gegangen sind, berichteten, was sie als Existenzgründer erlitten, erfreut und gelernt haben, und was sie beim zweiten Anlauf im Frühjahr 2016 besser machen wollen. Allerdings mochten das nur wenige WissensWerte-Besucher hören. Viele Stühle blieben leer.
Nun höre ich im Geiste schon Widerspruch: „Sie haben die falschen Sessions besucht, mit den falschen Leuten geredet.“ „Wo Sie Phlegma unterstellen, brodeln in Wahrheit Aufruhr und Tollkühnheit.“ – Wenn´s tatsächlich so ist, dann ist es ja gut…
Nur dies noch: Die Wissenschafts-PR und die Individualisten in der Blogosphäre haben es begriffen: Gegenwärtig entscheidet sich, welche Akteure auf welche Weise in Zukunft das Bild prägen werden, das sich die sogenannte Öffentlichkeit (die Politiker, die Drittmittelgeber und, und, und) von der Wissenschaft machen.
Es wäre schade, wenn sich der Wissenschaftsjournalismus sang- und klanglos abschaffen ließe. Als PR-Mann sage ich: Er wird auch in Zukunft noch dringend gebraucht.
Rettet Upday den Journalismus?
Dass sich der klassische Journalismus nicht mehr auf klassische Weise refinanzieren lässt, also mit Werbung, Einzelverkauf und Abonnenten, ist lange erwiesen. Ebenso, dass es bislang keinem Verlag gelungen ist, alternative Erlösmodelle zu entwickeln. Diese Feststellung trifft zumindest auf die Ware Journalismus zu. Ansonsten verticken Verlage inzwischen alles, was ein paar Euro Gewinn verspricht, vom Haustierbedarf (Burda) bis zum 3D-Drucker (Gruner + Jahr).
Auch Crowdfunding und Gemeinnützigkeit scheinen auf Dauer wenig geeignet, den Kapitalbedarf für Qualitätsjournalismus verlässlich zu sichern. Am Ende bleibt die bittere Einsicht: Journalismus wird zwar gelesen, egal ob gedruckt oder digital. Aber kaum ein Nutzer ist bereit, dafür einen Obulus zu entrichten.
Das war die Lage – bis jetzt. Nun aber hat das Duo aus Axel Springer und Samsung mit seiner App Upday die internationale Bühne betreten und eine neue Form von Journalismusfinanzierung in die Praxis umgesetzt: Springer sorgt für die Redaktion von Upday – und Samsung, die Nummer zwei im weltweiten Smartphone-Geschäft, zahlt die Zeche.
In Zeiten, in denen das Innovationspotenzial der Hardware ausgereizt und die Geräte trotz verschiedener Hersteller austauschbar geworden sind, braucht die Industrie neue Differenzierungsmerkmale. Ein eigener hochwertiger Medienservice, global ausgerichtet, ist ein solches Merkmal, mit dem man Käufer anziehen will.
Gewiss, auch Apple wird mit seinem nächsten iOS-Update eine vorinstallierte App „Apple News“ anbieten, für die 50 Inhaltelieferanten verpflichtet werden konnten. Aber die Idee von Upday reicht weiter. Hier werden nicht bloß Inhalte aus verschiedenen Medienquellen zusammengeführt, sondern eine eigene Redaktion versorgt ein weltweites Publikum mit eigens kreierten Qualitätsinhalten.
Im wahren Geschäftsleben wäre ein solches Projekt für jeden Verlag ruinös. Samsung hingegen bezahlt das Projekt Upday aus der Portokasse – ähnlich wie Jeff Bezos, dessen Sparstrumpf auch nach dem Kauf der Washington Post noch prall gefüllt sein dürfte. Bezos verkaufte seinen Coup als Mäzenaten-Romanze. Das war geflunkert, denn natürlich nutzt Bezos die Washington Post, um neues Geschäft zu generieren.
Auch Samsung finanziert den Upday-Journalismus nicht aus Mildtätigkeit. Aber spricht etwas dagegen? Warum sollte unabhängiger Journalismus nicht auch dann möglich sein, wenn ihn Samsung bezahlt? Würde der Hardware-Gigant Einfluss nehmen auf die Inhalte, die die Springer-Redaktion über Upday ausspielt, wäre der Eklat programmiert. Nein, auf den ersten Blick hat das Modell nur zwei Gewinner: Springer avanciert auf einen Schlag zum global wahrnehmbaren Inhaltelieferanten. Und Samsung sichert seinen weltweiten Marktanteil.
Wird das bislang Unvorstellbare zukunftsfähig: Rettet die Industrie den Journalismus?
Zensur: Drittmittel-Unternehmen verbietet Helmholtz-Forschungsbericht
Eben kam die neue Ausgabe der Zeitschrift „Wissenschaftsmanagement“ auf meinen Schreibtisch. Druckfrisch zwar, aber mit sage und schreibe fünf Monaten Verspätung! Den Grund dafür finden Leserinnen und Leser der Nr.1/15 auf den Seiten 32-35; diese mussten von der Redaktion komplett unleserlich gemacht werden (Foto). Eine ungenannte Firma, die einem ebenfalls ungenannten Helmholtz-Zentrum Geld für Forschung gespendet hatte, wollte das so. Ein zeitgenössischer Fall von Zensur. Und ein Vorgeschmack auf das, was der Freiheit der Wissenschaft blüht, wenn sie sich von Drittmitteln aus der Wirtschaft abhängig macht.
„Abgestimmt, geschrieben, gesetzt, korrigiert“, sei der Artikel gewesen, schreibt Chefredakteur Markus Lemmens in seiner Erläuterung des Vorfalls – aber „dann keine Freigabe für den Druck“. Das finanzierende Unternehmen im Ausland verweigerte seine Zustimmung und ließ sich auch nicht von vielen Depeschen aus dem Helmholtz-Zentrum umstimmen. Im Gegenteil: Weil offenbar „juristische Folgen“ angedroht wurden, blieb der Redaktion nichts übrig, als die bereits produzierten Seiten so zu rastern, dass kein Wort mehr lesbar, kein Foto mehr erkennbar ist.
Gut, dass es zu diesem Fall von Zensur gekommen ist. Denn so wird der Scientific Community und ihren Managern schnörkellos vor Augen geführt, wie trügerisch die Finanzierung von Forschung durch Drittmittel aus der Wirtschaft sein kann.
Das betroffene Helmholtz-Institut habe sich bei seinem Finanzier für die Publizierung des Artikels stark gemacht, hebt Chefredakteur Lemmens hervor. Dass man auf taube Ohren stieß, unterstreicht meines Erachtens, wer in solchen sogenannten Partnerschaften die Richtung vorgibt – und ohne zu fackeln mit der juristischen Keule droht, wenn etwas nicht nach den Wünschen des Auftraggebers läuft.
Dass sich ein kleines Fachmagazin wie „Wissenschaftsmanagement“ zähneknirschend dem juristischen Druck beugt, ist nur zu verständlich. Dass die Redaktion den Vorgang aber trotzdem öffentlich macht, ist mutig. So sind wir gezwungen, uns auch mal mit den Schattenseiten der vielgerühmten Koooperation von Hochschule, Forschung & Wirtschaft auseinanderzusetzen.
Wissenschaftler! Welche PR wollt ihr eigentlich?
„Bashing der Wissenschafts-PR“ nennt Markus Lehmkuhl sein Dossier im Meta-Magazin. Moment mal! War nicht eben noch allerorten die Rede vom „Sommer der Wissenschaftskommunikation“ als Metapher für Aufbruch und Neuanfang? Siggener Kreis, Akademien-Empfehlung („WÖM“) und ein Workshop der VolkswagenStiftung wurden als Impulse wahrgenommen, um im offenen Austausch miteinander das Verhältnis und die Interaktion von Wissenschaft, von PR und Wissenschaftsjournalismus auf ein neues, qualitativ besseres Fundament zu stellen.
Doch ein Spiegel Online-Gespräch über „Wissenschaft in den Medien“ machte im Februar 2015 deutlich, wie tief die Gräben nach wie vor sind, die die Wissenschafts-PR von ihren Bezugsgruppen trennt. Tragischerweise sogar von Teilen der Wissenschaft selbst. Denn wie sonst lässt sich erklären, dass der prominente Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer im erwähnten Gespräch die Initiative Wissenschaft im Dialog (WiD) als „reine Geldverschwendung“ bezeichnet und den Organisatoren von Wissenschaftsjahren und Wissenschaftsstädten empfiehlt, sie „sollten sich schämen“.
Fischer ist Medienprofi genug, um zu wissen, wie man mit Zuspitzungen Aufmerksamkeit erzeugt. Und gewiss zielt seine Schelte nicht allein auf WiD. Dahinter steht eine diffuse Unzufriedenheit mit der Wissenschafts-PR im Allgemeinen. Auch Markus Lehmkuhl geht in seinem Dossier mit WiD hart ins Gericht. Die Initiative habe nichts zu einer „wissenschaftlichen Rationalisierung gesellschaftlich relevanter Debatten“ beigetragen. Er erinnert daran, dass die großen Wissenschaftsorganisationen, die bis heute übrigens auch die Grundfinanziers von WiD sind, sich 1999 in einem Memorandum verpflichtet hätten, einen „permanenten Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu etablieren“. Lehmkuhls Fazit heute: „Was als durchaus ernsthafter Versuch einer dialogorientierten Wissenschaftskommunikation gestartet ist, ist praktisch zu einer Art Imagekampagne geworden, bei der sehr zweifelhaft ist, ob sie das Wesen der Wissenschaft nicht eher verdeckt als es offenbar werden zu lassen.“
Anders als Fischer im Spiegel Online-Gespräch fokussiert Lehmkuhl seine Kritik an der Wissenschafts-PR aber nicht auf WiD als gern gegriffenes Fallbeispiel. Für ihn trägt vielmehr „die“ Wissenschaft selbst eine erhebliche Mitverantwortung an den Fehlentwicklungen, die sie nun öffentlichkeitswirksam kritisiert. Als Belege zieht Lehmkuhl in seinem Dossier Studien heran, die in sogenannten High Impact-Journals erschienen sind und nachweisen, wie auch Wissenschaftler sich bei der Kommunikation ihrer Forschungsergebnisse, bisweilen sogar schon bei der Festlegung auf Vorhaben, an Vermarktungs- und PR-Strategien orientieren, und welchen Anteil Wissenschaftler am Zustandekommen von Pressemitteilungen haben, denen sie man später vorwerfen, sie würden Forschungsbefunde übertreiben, sensationalisieren, verzerren.
Diese Studien sind bekannt, die Befunde nicht neu. Aber neu ist, wenn man Lehmkuhl folgt, die kritische Selbstreflexion dieser Phänomene innerhalb des Wissenschaftssystems, auch in den sogenannten „harten“ Naturwissenschaften. Mögen Kommunikations- und Medienwissenschaftler sich in der Vergangenheit noch so abgemüht haben, mit kritischen Studien auf das Publikationsverhalten ihrer Kollegen in anderen Disziplinen pädagogisch einzuwirken – es hat kaum interessiert. Das scheint sich jetzt zu ändern.
Das überzeugendste Signal dafür sind die Empfehlungen der Akademien („WÖM“), hinter der eine heterogene Gruppe angesehener Experten und – auch technik- und naturwissenschaftlich fokussierter – Institutionen steht, deren zentraler Appell, in Lehmkuhls Worten, lautet: „Hört auf, PR zu machen! Denn sie trägt zum Vertrauensverlust der Wissenschaft bei.“
Für die Wissenschaft ist es, nach Lehmkuhl, höchste Zeit, nicht nur die „eigene irregeleitete PR-Maschinerie“ in den Griff zu kriegen, sondern auch ihren eigenen, immer wieder formulierten Aufklärungsanspruch einzulösen. Zu lange habe sich Forschungskommunikation unter dem Publikationsdruck am Neuigkeitswert und an der Spektakularität orientiert: „Stattdessen muss sie sich darauf konzentrieren, gesellschaftlich relevante wissenschaftliche Informationen von irrelevanten zu unterscheiden und diese relevanten Informationen sachadäquat und für Laien verständlich aufzubereiten.“
Wie Lehmkuhl seine Argumentation in vier Kapiteln ausbreitet, lohnt auf jeden Fall die Lektüre. Am Ende wird klar, dass das „Bashing der Wissenschafts-PR“, dem zumindest ein Teil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht abgeneigt ist, ein Verdrängungsreflex ist. Denn so mogelt sich die Wissenschaft aus der Mitverantwortung für vieles, was sie an ihren Pressestellen und Eventmanagern kritisiert.
Dass die PR letztlich auch nur ein Abbild der Kultur der Wissenschaft selbst ist, beschreibt Markus Weißkopf, Geschäftsführer der gescholtenen Institution WiD, in einem Kommentar zu Lehmkuhls Dossier sehr anschaulich: „Es gibt Professoren, die morgens eine etwas übertrieben formulierte Pressemitteilung an ihre Pressestelle senden und sich am Nachmittag über die Medialisierung beschweren. Einige wünschen sich eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit, ähnlich wie in einem Unternehmen, andere eine, die sämtliche Imagekommunikation beiseitelässt.“
Gut 15 Jahre nach PUSH lässt sich konstatieren, dass die Wissenschaft die seinerzeit formulierten Ziele (z.B. Akzeptanzsicherung für die Wissenschaft und Aufklärung der Öffentlichkeit über Wissenschaft mittels Beteiligung an gesellschaftlichen Diskursen) offenbar weder mit dem nötigen Interesse, noch mit der nötigen Verantwortung verfolgt und beaufsichtigt hat. Stattdessen wurde das bis heute wenig geliebte Thema „Öffentlichkeitsarbeit“ an Pressestellen, Eventabteilungen und an organisationsübergreifende Institutionen delegiert.
Die Wissenschaft macht es sich deshalb einfach, wenn sie sich auf Distanz zu den PR-Profis begibt. Stattdessen ist mehr denn je der Dialog wünschenswert. Wissenschaft und PR müssen sich auf gemeinsame Ziele verständigen. Das wird nicht mit globalen Regelwerken funktionieren (wobei ein PUSH-II durchaus als Referenz nützlich wäre), sondern muss wohl individuell ausgehandelt werden. Dass auch die Pressestellen mit dem Status Quo nicht zufrieden sind, belegen Aktivitäten wie der Siggener Kreis, über den ich hier schon geschrieben habe, der aber auf die Kritiker in der Wissenschaft bislang offenbar keinen Eindruck macht.
Dass der eingangs zitierte „Sommer der Wissenschaftskommunikation“ schon wieder vorbei ist, glaube ich nicht. Nach wie vor ist die zentrale Aufgabe nicht gelöst, der sich alle Akteure von Wissenschaftskommunikation stellen müssen. Es wird darum gehen, sich im Dialog der Bezugsgruppen gegenseitig zu versichern, welche Form der Kommunikation man sich wünscht, um welche Ziele zu erreichen.
Die VolkswagenStiftung bereitet einen Workshop vor (#wowk15), die sich am 5. und 6. Oktober 2015 diesem Thema stellen soll. Der Fokus wird auf dem Kommunikationsverhalten der Wissenschaft liegen – und ihren Erwartungen an die Interaktion mit anderen Bezugsgruppen.
Ein „Bashing“ wird es dort für keine Akteursgruppe geben. Stattdessen einen vorbehaltlosen Dialog. Hoffentlich. Denn ohne den kommen wir alle nicht weiter.